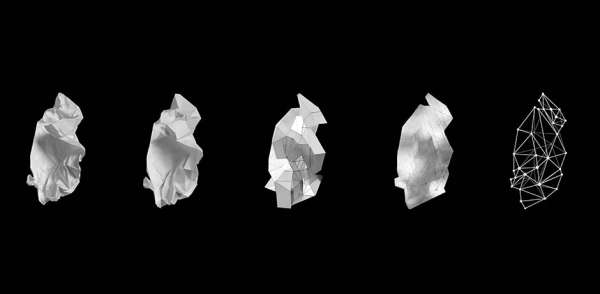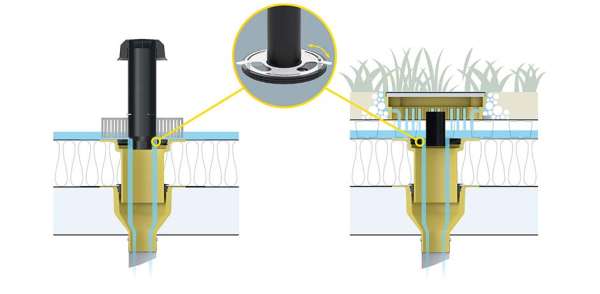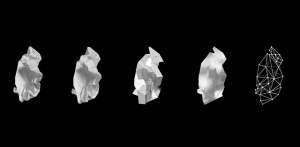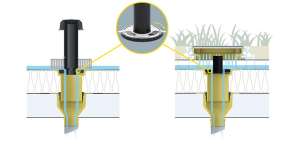Das Paul-Ottmann Zentrum in München Aubing gilt als Einkaufszentrum als sozialer Dreh- und Angelpunkt des Stadtteils Aubing. Erbaut in den Siebzigerjahren ist der Bau von Grund auf sanierungsbedürftig und muss modernen Anforderungen angepasst werden, wie Brandschutzauflagen, Barrierefreiheiten und Energie-Vorgaben.
Im Rahmen der weiteren Entwicklung von Neuaubing und Westkreuz soll zudem die Attraktivität und Nachhaltigkeit des Stadtteils gezielt gestärkt werden. Aufgabe an die geladenen Architekturbüros war es, neben Gewerbeflächen auch Raum für Ärzte, eine Stadtsparkassenfiliale, die Stadtteilbibliothek aber auch Wohnungen und eine Kindertagesstätte zu konzipieren.
Die Bauherren SBI GmbH und Müller Beteiligung-Aubing GmbH & Co KG lobten hierfür gemeinsam mit der Stadt München einen Architekturwettbewerb aus. Aus 10 Beiträgen wählte die Jury unter Vorsitz von Prof. Ulrike Lauber den Beitrag des Münchner Büros Allmann Sattler Wappner Architekten zum Siegerentwurf.
Vom 27.4. bis 9.5.2015 sind die Wettbewerbsbeiträge öffentlich ausgestellt:
»Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse zum Paul-Ottmann Zentrum«
Ausstellungsort: Radolfszeller Straße 15, 2.OG,
Eingang rechts neben der Stadtbibliothek
Mo – Fr: 12.00 bis 18.00 Uhr
Wettbewerb 2015: 1. Preis
Standort: Am Westkreuz, München Aubing
Bauherr: SBI GmbH und Müller Beteiligung-Aubing GmbH & Co KG
Entwurf:
Allmann Sattler Wappner Architekten GmbH
mit Landschaftsarchitekt MAN MADE LAND Bohne Lundquist Melier GbR, Berlin
Carola Dietrich
Philipp Vogeley
Pavel Shcherbakov
Daniel Albrecht
Katarzyna Juszczyszyn
Visualisierung: vizoom berlin
Aus dem Erläuterungsbericht der Architekten, Allmann Sattler Wappner Architekten:
STÄDTEBAULICHES KONZEPT
Ausgangslage: Der Münchner Stadtraum ist geprägt durch die Aufstellung einzelner, durch einen Grünraum gebundener, Gebäude. Die Defizite dieser Form von Stadtplanung zeigen sich deutlich im bestehenden Paul-Ottmann Zentrum. Die Freiräume und Gebäude sind zumeist unspezifisch, die verschiedenen Höhenniveaus erschweren die Zugänglichkeit, das Verhältnis zwischen Haus und öffentlichem Raum bleibt ungeklärt. Das Wohnhochhaus (Ramses) dominiert den Ort visuell, seine erdgeschossigen Nutzungen sind jedoch privat und verhindern somit öffentlichen Stadtraum.
Ziel des Konzeptes der Architekten ist es daher einen eindeutigen Platz zu formulieren auf den sich alle öffentlichkeitswirksamen Nutzungen hin orientieren. Um den Zentrumsgedanken zu stärken wird der stereotypen Orthogonalität der umgebenden Bebauung durch die Setzung zweier polygonaler Baukörper entgegengearbeitet. Die Höhen werden normalisiert, Schwellen soweit wie möglich aufgelöst und Blickbeziehungen geöffnet. Als Ausgleich zum jetzigen Parkhaus wird eine zweigeschossige Tiefgarage unter dem nun auf Straßenniveau liegenden Platz angeordnet. Die Unterführung entfällt zugunsten eines Fußgängerüberweges, der die beiden Plätze verbindet.
ARCHITEKTONISCHES KONZEPT
Die beiden polygonalen Baukörper werden durch eine differenzierte Ausformung der Volumen in eine Äquivalenz signalisierende Balance gebracht. Den Dachaufsichten der Gebäude kommt in Anbetracht des benachbarten Hochhauses eine besondere Bedeutung zu. Die Dachfläche wird durch das Herunterfalten auf Erdgeschossniveau zum nutz-und erlebbaren Aussenraum. Durch diese Maßnahme öffnen sich die Höfe zudem zu einer Längsseite hin und verlieren dadurch ihren einschließenden Charakter. Um die Halböffentlichkeit dieser Flächen zu betonen, wird der Zugang bewusst von den, dem zentralen Platz abgewandten, Seiten, ermöglicht.
Damit möglichst wenige Treppenhäuser die wertvollen Erdgeschossflächen trennen und besetzen, werden die Wohnungen auf den Dächern der Ladenflächen durch Laubengänge erschlossen. Die Anordnung des Kindergartens im Obergeschoss erlaubt die Orientierung auf einen geschützten und gut besonnten Freiraum. Die obergeschossigen Gewerbeflächen lassen sich in mehrere Einheiten teilen und werden vom zentralen Platz erschlossen. Die Bibliothek wird ihrer öffentlichen Bedeutung gemäß an der prominentesten Stelle im zweiten Obergeschoss angeordnet.
Materialität: Durch die gewählte Materialität wird an dem Ort eine bisher nicht vorhandene Feinheit und strukturelle und haptische Qualität in der Beschaffenheit der Oberflächen eingeführt. Die vertikale Linierung gibt den Gebäuden eine Tiefe und Plastizität und verbunden mit Wahl der Materialien Fiberzement und Holz einen werthaltigen Ausdruck.