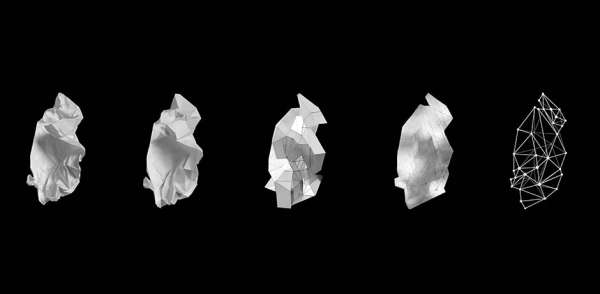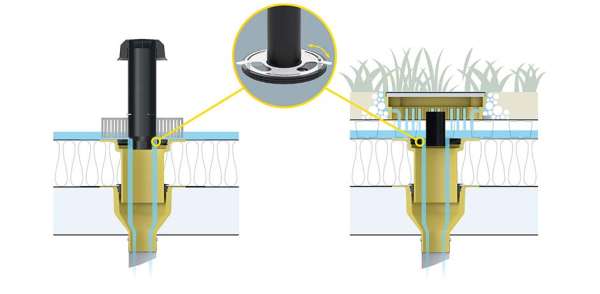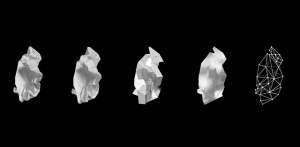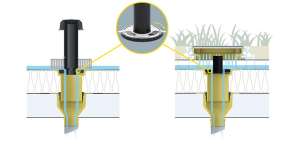Im September eröffnete das neue Bauhausmuseum in Dessau – passend zum 100-jährigen Jubiläum der legendären Hochschule für Gestaltung. Nach dem Haus-im-Haus-Prinzip entwarf das junge spanische Büro addenda architects einen scheinbar schwebenden Betonbaukörper in einer leichten Hülle aus Glas. Um die Betonoberflächen zu veredeln, setzten die Planer auf eine Lasur von KEIM.
Zuletzt platzte das Dessauer Bauhaus aus allen Nähten. Das Hauptgebäude und die Meisterhäuser von Walter Gropius, seit langem auch als Ausstellungsfläche genutzt, boten einfach nicht mehr genug Platz für die umfangreiche Sammlung, deren 49.000 Exponate die Geschichte des Bauhauses erzählen. Hinzu kam: Da es sich zum Teil um empfindliche Gegenstände mit hohen konservatorischen Anforderungen handelt, ließen sie sich in den Bestandsgebäuden nur bedingt zeigen, denn deren Status als UNESCO-Welterbe erschwerte den Einbau einer leistungsfähigen Klimatechnik. Daher wurde ein Neubau nötig, der nicht nur mehr Fläche bereitstellen, sondern indirekt auch zum schonenden Umgang mit den denkmalgeschützten Altbauten beitragen sollte. Um das Projekt finanziell stemmen zu können, taten sich gleich drei Akteure der öffentlichen Hand zusammen: Der Bund und das Land Sachsen-Anhalt trugen die Baukosten von 28 Millionen Euro zu gleichen Teilen und die Stadt Dessau stellte ein Grundstück bereit. Man entschied sich für ein parkartiges Areal am Rande der Fußgängerzone. So würden die Besucher helfen, das eher ruhige Stadtzentrum Dessaus zu beleben.
Glasklares Entwurfskonzept
In einem europaweit ausgeschriebenen Architekturwettbewerb mit 831 Einsendungen setzte sich das junge Büro addenda aus Barcelona durch. Es plante einen langen Riegel, der aus der Straßenflucht zurückspringt und dadurch einen Vorplatz erzeugt, einen öffentlichen Raum, durch den die Bedeutung des Museums im urbanen Gefüge unterstrichen wird. Genau an der Stelle, an der die Ratsgasse vom Stadtkern kommend auf den Platz trifft, liegt der Haupteingang zum Museum. Wer durch die vollverglaste Fassade des Gebäudes eintritt, entdeckt im Inneren einen schmalen schwarzen Betonkörper von 108 Metern Länge. Statt auf dem Boden zu lagern, scheint er über dem Erdgeschoss zu schweben, nur an den beiden Enden ruht er jeweils auf einem kleineren Betonkörper, sodass eine Art Brücke entsteht. Während das Erdgeschoss als großer offener Raum vor allem Foyer, Shop, Cafeteria und die Wechselausstellungen aufnimmt, beherbergt der Brückenkörper die Dauerausstellung. Als „Black Box“ konzipiert, zeigt er sich nach außen vollkommen geschlossen und bietet mit seinen schweren Betonwänden ausreichend thermische Masse, die es erleichtert, stets ein ausgeglichenes Raumklima für die schonende Präsentation der Exponate bereitzustellen. In seinem Inneren findet sich keine weitere räumliche Unterteilung, sondern ein einziger großer stützenfreier Saal. Er gewährt den Kuratoren alle Freiheiten für die Inszenierung der Sammlung. 2.100 Quadratmeter Ausstellungsfläche stehen ihnen zur Verfügung, insgesamt bietet das Bauwerk 3.500 Quadratmeter Nutzfläche. Die Idee der geschlossenen Schachtel in einer gläsernen Hülle lässt das Museum wie eine Vitrine erscheinen, ein Effekt der vor allem bei Dunkelheit zum Tragen kommt, wenn innen die Lichter angehen und das Haus nach außen strahlen lassen.
Gezielter Farbeinsatz
Um die „Black Box“ als zentrales, eigenständiges Element des Entwurfs zu betonen, wurden die Wände farblich behandelt. Kamen sämtliche Betonoberflächen zunächst im gleichen Grauton aus der Schalung, so wurden sie anschließend in zwei unterschiedlichen Tönen aus dem Hause KEIM gefasst. Die unteren Baukörper, auf denen die Box ruht, erhielten eine aufhellende Lasur in einem Lichtgrau, der lange, schwebende Körper dagegen eine stark verdunkelnde Lasur in einer Anthrazit-Nuance (Concretal 9008). Die ruppige Erscheinung der Wände, die nicht in edlem Sicht- sondern in normalem Konstruktionsbeton ausgeschrieben waren, blieb dabei ebenso erhalten wie ihr steinerner Charakter: Als mineralische Beschichtung bewahrt die KEIM-Lasur die raue, offenporige Betonstruktur, da sie keinen Film auf der Oberfläche bildet. Auch im Inneren der Box zeigen die Wände nun den dunklen Farbton.
Ausgeführt wurden die Arbeiten von den Malerwerkstätten Heinrich Schmid, einem Betrieb direkt aus Dessau. Zunächst befreite der Mitarbeiter die Oberflächen mit Betonschnellreiniger von Verschmutzungen, dann legte er mehrere große Musterflächen an. Nachdem Farbtöne und Deckungsgrad bestimmt worden waren, trug er die Concretal-Lasur in zwei Arbeitsgängen auf. Insgesamt waren mehr als 8.000 Quadratmeter zu behandeln, sodass er ein Airless-Gerät verwendete. Um ein möglichst gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, war es wichtig, dass die komplette Fläche von derselben Person bearbeitet wird, denn trotz des maschinellen Verfahrens hat jeder Maler eine eigene „Handschrift“, je nachdem wie er die Spritzpistole führt. Daher dauerte es mehrere Wochen, bis alle Wandflächen fertig lasiert waren.
Solche Details der Ausführung werden die Besucher wahrscheinlich nicht bewusst wahrnehmen, und doch tragen sie zur räumlichen Wirkung im Inneren der Box bei: Dort lässt der dunkle Farbton die Wände optisch beinahe verschwinden und bildet dank der gleichmäßigen Oberfläche einen neutralen Hintergrund, vor dem die bunt gefassten mobilen Wände des Ausstellungsdesigns, vor allem aber die Bauhaus-Exponate umso deutlicher zur Geltung kommen.
Bautafel
Architektur: addenda architects, www.addendaarchitects.com
Ausführender Fachbetrieb: Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
Verwendete KEIM-Produkte:
KEIM Betonschnellreiniger
KEIM-Concretal Lasur 9008