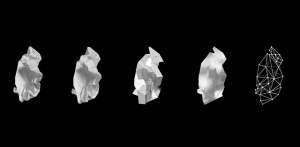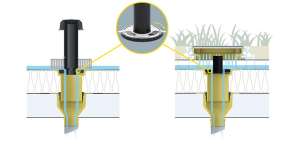Der Wolfgang Hartmann Preis für junge KunsthistorikerInnen geht 2011 an unsere Autorin und Inhaberin von deconarch Simone Kraft M.A. (Heidelberg). Ausgezeichnet wird ihr Ausstellungskonzept »(In)Visible Cities«, das der ganz alltäglichen urbanen Architektur nachspürt und die vermeintlich unsichtbar gewordene Stadt wieder sichtbar werden lässt.
Der Wolfgang Hartmann Preis für junge KunsthistorikerInnen geht 2011 an unsere Autorin und Inhaberin von deconarch Simone Kraft M.A. (Heidelberg). Ausgezeichnet wird ihr Ausstellungskonzept »(In)Visible Cities«, das der ganz alltäglichen urbanen Architektur nachspürt und die vermeintlich unsichtbar gewordene Stadt wieder sichtbar werden lässt. (In)Visible Cities: Simone Kraft erhält den Wolfgang Hartmann Preis 2011
 Der Wolfgang Hartmann Preis für junge KunsthistorikerInnen geht 2011 an unsere Autorin und Inhaberin von deconarch Simone Kraft M.A. (Heidelberg). Ausgezeichnet wird ihr Ausstellungskonzept »(In)Visible Cities«, das der ganz alltäglichen urbanen Architektur nachspürt und die vermeintlich unsichtbar gewordene Stadt wieder sichtbar werden lässt.
Der Wolfgang Hartmann Preis für junge KunsthistorikerInnen geht 2011 an unsere Autorin und Inhaberin von deconarch Simone Kraft M.A. (Heidelberg). Ausgezeichnet wird ihr Ausstellungskonzept »(In)Visible Cities«, das der ganz alltäglichen urbanen Architektur nachspürt und die vermeintlich unsichtbar gewordene Stadt wieder sichtbar werden lässt. 

 Der Berliner Architekt und Künstler Jochen Eisentraut schafft Bilder, die oft Grenzgänge zwischen Kunst und Architektur, aber auch zwischen den Medien sind: Gezeichnete Skizzen überträgt er in den Computer und verwandelt sie dort in dreidimensionale räumliche Gebilde. Linienwirbel fügen sich zusammen zu überraschenden, komplexen Ansichten.
Der Berliner Architekt und Künstler Jochen Eisentraut schafft Bilder, die oft Grenzgänge zwischen Kunst und Architektur, aber auch zwischen den Medien sind: Gezeichnete Skizzen überträgt er in den Computer und verwandelt sie dort in dreidimensionale räumliche Gebilde. Linienwirbel fügen sich zusammen zu überraschenden, komplexen Ansichten. Die junge Dresdner Künstlerin Yasmin Alt erforscht plastisch, wie architektonische Formen funktionieren. Sie »baut« ihre architektonischen Vorbilder nach, die sie auf ihre Grundformen, ihre Basis-Struktur reduziert, um ihrer Funktionsweise auf die Spur zu kommen – jedoch nicht, wie diese Bauten genutzt werden, sondern was beim Bauen (mit) dieser(n) Formen geschieht: Zugrunde liegt die Beobachtung, dass bestimmte Formen im Laufe der Zeit wiederkehren in unterschiedlichen Bautypen – so etwa die Entwicklung der »Halle« von der antiken Basilika über den Kirchenbau hin zu Fabrikhallen in monumentalen Dimensionen.
Die junge Dresdner Künstlerin Yasmin Alt erforscht plastisch, wie architektonische Formen funktionieren. Sie »baut« ihre architektonischen Vorbilder nach, die sie auf ihre Grundformen, ihre Basis-Struktur reduziert, um ihrer Funktionsweise auf die Spur zu kommen – jedoch nicht, wie diese Bauten genutzt werden, sondern was beim Bauen (mit) dieser(n) Formen geschieht: Zugrunde liegt die Beobachtung, dass bestimmte Formen im Laufe der Zeit wiederkehren in unterschiedlichen Bautypen – so etwa die Entwicklung der »Halle« von der antiken Basilika über den Kirchenbau hin zu Fabrikhallen in monumentalen Dimensionen. Zum 1. Januar 2012 übernimmt Susanne Weiß die Direktion des Heidelberger Kunstvereins. Die Berliner Kuratorin und Kunstvermittlerin tritt damit die Nachfolge Johan Holtens an, der seit dem 1. April 2011 die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden leitet.
Zum 1. Januar 2012 übernimmt Susanne Weiß die Direktion des Heidelberger Kunstvereins. Die Berliner Kuratorin und Kunstvermittlerin tritt damit die Nachfolge Johan Holtens an, der seit dem 1. April 2011 die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden leitet. Am 19. April 2011 erscheint die aktuelle Architektur-Zeitschrift von Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar. Die aktuelle Ausgabe von HORIZONTE widmet sich dem Thema »RE-DEFINITION – Architektur auf der Suche nach neuen Wegen«. Essays, Fotoreihen und Projektbeschreibungen zeigen einen neuen Umgang mit Architektur
Am 19. April 2011 erscheint die aktuelle Architektur-Zeitschrift von Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar. Die aktuelle Ausgabe von HORIZONTE widmet sich dem Thema »RE-DEFINITION – Architektur auf der Suche nach neuen Wegen«. Essays, Fotoreihen und Projektbeschreibungen zeigen einen neuen Umgang mit Architektur Es gibt Bücher, die machen einfach Spaß, meint unser Autor Christian J. Grothaus. Man nimmt sie öfter in die Hand als andere, dreht und wendet sie, blättert die Seiten wie im Daumenkino immer wieder schell ab und freut sich über den leicht artifiziell, aber nicht unangenehm duftenden Windzug, der dabei entsteht. Man lässt die Hände über den Einband geleiten, über Front und Rücken und empfindet es als angenehm, ein wenig samtenen Widerstand dabei zu spüren.
Es gibt Bücher, die machen einfach Spaß, meint unser Autor Christian J. Grothaus. Man nimmt sie öfter in die Hand als andere, dreht und wendet sie, blättert die Seiten wie im Daumenkino immer wieder schell ab und freut sich über den leicht artifiziell, aber nicht unangenehm duftenden Windzug, der dabei entsteht. Man lässt die Hände über den Einband geleiten, über Front und Rücken und empfindet es als angenehm, ein wenig samtenen Widerstand dabei zu spüren. Am Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart entsteht online unter www.cranach.net derzeit die weltweit umfangreichste Datenbank zum künstlerischen Werk Lucas Cranachs des Älteren und seiner Werkstatt. Das Netzwerk ist die Arbeitsplattform des »Cranach Research Institute« , einem Forschungsprojekt zur Aufbereitung des Gesamtwerks des Künstlers mit dem Ziel, wissenschaftlich fundierte Inhalte mit schnellen Zugriffsmöglichkeiten zu schaffen.
Am Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart entsteht online unter www.cranach.net derzeit die weltweit umfangreichste Datenbank zum künstlerischen Werk Lucas Cranachs des Älteren und seiner Werkstatt. Das Netzwerk ist die Arbeitsplattform des »Cranach Research Institute« , einem Forschungsprojekt zur Aufbereitung des Gesamtwerks des Künstlers mit dem Ziel, wissenschaftlich fundierte Inhalte mit schnellen Zugriffsmöglichkeiten zu schaffen. MORMO (Mein Moskau) ist ein Stadtlesebuch – genauer noch: ein Stadt-Lese-und-Schau-Buch –, das nicht zum schnellen Durchblättern geeignet ist. MORMO will in Ruhe gelesen werden, immer wieder zur Hand genommen und goutiert werden. Auf über 200 Seiten versammelt MORMO Fotografien und Kurztexte, die die russische Hauptstadt porträtieren, visualisieren, beschreiben, sie in alltäglichen Momentaufnahmen ebenso plastisch vor Augen treten lassen wie in architekturhistorisch interessanten Ansichten
MORMO (Mein Moskau) ist ein Stadtlesebuch – genauer noch: ein Stadt-Lese-und-Schau-Buch –, das nicht zum schnellen Durchblättern geeignet ist. MORMO will in Ruhe gelesen werden, immer wieder zur Hand genommen und goutiert werden. Auf über 200 Seiten versammelt MORMO Fotografien und Kurztexte, die die russische Hauptstadt porträtieren, visualisieren, beschreiben, sie in alltäglichen Momentaufnahmen ebenso plastisch vor Augen treten lassen wie in architekturhistorisch interessanten Ansichten Seine Arbeiten wecken überraschend gegensätzliche Assoziationen wie Ruhe und Geschwindigkeit, Abstraktion und Kontemplation. Reduziert auf Farbflächen zeigen diese Kunstwerke nichts anderes als geometrische Formen und Farben, Volumen und Oberflächen, die nur auf sich selbst verweisen. Er wolle die Spannung einfangen, die von Ruhe ausgeht, sagt der Schweizer Künstler Pierre Juillerat. Er versuche, den mentalen Raum zu artikulieren, der zwischen den Gedanken herrsche, den Zwischenraum zwischen Intuition und Intelligenz.
Seine Arbeiten wecken überraschend gegensätzliche Assoziationen wie Ruhe und Geschwindigkeit, Abstraktion und Kontemplation. Reduziert auf Farbflächen zeigen diese Kunstwerke nichts anderes als geometrische Formen und Farben, Volumen und Oberflächen, die nur auf sich selbst verweisen. Er wolle die Spannung einfangen, die von Ruhe ausgeht, sagt der Schweizer Künstler Pierre Juillerat. Er versuche, den mentalen Raum zu artikulieren, der zwischen den Gedanken herrsche, den Zwischenraum zwischen Intuition und Intelligenz. Der Kölner Künstler Simon Schubert hat eine einzigartige Ausdrucksform entwickelt: Durch eine besondere Falttechnik verwandelt er Papier in erstaunliche Relief-Bilder. Meist sind es Innenräume, die er mit dieser außergewöhnlichen Vorgehensweise – das genaue Verfahren ist geheim – festhält. Durch die Faltungen entsteht die Wirkung eines Negativabdrucks eines Raumes, etwa so, wie man es als Kind häufig getan hat, wenn man eine Münze unter ein Blatt Papier gelegt und diese mit Bleistift abschraffiert hat.
Der Kölner Künstler Simon Schubert hat eine einzigartige Ausdrucksform entwickelt: Durch eine besondere Falttechnik verwandelt er Papier in erstaunliche Relief-Bilder. Meist sind es Innenräume, die er mit dieser außergewöhnlichen Vorgehensweise – das genaue Verfahren ist geheim – festhält. Durch die Faltungen entsteht die Wirkung eines Negativabdrucks eines Raumes, etwa so, wie man es als Kind häufig getan hat, wenn man eine Münze unter ein Blatt Papier gelegt und diese mit Bleistift abschraffiert hat.  Frédéric Chaubin, Chefredakteur des französischen Lifestyle-Magazins »Citizen K.« , macht derzeit seinen neuen Architektur-Bildband bekannt. Bis 2010 hatte er sieben Jahre lang den Raum der ehemaligen Sowjetunion bereist und dokumentierte das bauende Schließen eines Kreises. Die Erben dessen nämlich, was so enthusiastisch als russischer Konstruktivismus im Anschluss an die Oktoberrevolution von 1917 begann und im Blick auf das architektonische Potential keineswegs den Vergleich mit dem Weimarer »bauhaus« scheuen muss, fanden offensichtlich zu ihren Wurzeln zurück.
Frédéric Chaubin, Chefredakteur des französischen Lifestyle-Magazins »Citizen K.« , macht derzeit seinen neuen Architektur-Bildband bekannt. Bis 2010 hatte er sieben Jahre lang den Raum der ehemaligen Sowjetunion bereist und dokumentierte das bauende Schließen eines Kreises. Die Erben dessen nämlich, was so enthusiastisch als russischer Konstruktivismus im Anschluss an die Oktoberrevolution von 1917 begann und im Blick auf das architektonische Potential keineswegs den Vergleich mit dem Weimarer »bauhaus« scheuen muss, fanden offensichtlich zu ihren Wurzeln zurück. Es ist die Verschränkung von Kunst, Architektur und Wissenschaft, die die Arbeit von Annett Zinsmeister auszeichnet. Als eine Grenzgängerin der Disziplinen vereint sie in ihrem Schaffen souverän die Arbeit als Künstlerin und Architektin, als Designerin und Kultur- und Medienwissenschaftlerin. Als Professorin für Gestaltung und Experimentelles Entwerfen lehrt sie seit 2007 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, seit 2009 hat sie zudem die Leitung des Weissenhof-Instituts inne
Es ist die Verschränkung von Kunst, Architektur und Wissenschaft, die die Arbeit von Annett Zinsmeister auszeichnet. Als eine Grenzgängerin der Disziplinen vereint sie in ihrem Schaffen souverän die Arbeit als Künstlerin und Architektin, als Designerin und Kultur- und Medienwissenschaftlerin. Als Professorin für Gestaltung und Experimentelles Entwerfen lehrt sie seit 2007 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, seit 2009 hat sie zudem die Leitung des Weissenhof-Instituts inne